Verlässlichkeit ist eines dieser Themen, bei dem die meisten von uns wahrscheinlich glauben, zu wissen, was gemeint ist. Bis wir dann auf schmerzhafte Weise erfahren, dass jeder etwas anderes darunter versteht. Besonders in Beziehungen – sei es freundschaftlich, partnerschaftlich oder familiär – prallen da schnell unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen aufeinander.
Was Verlässlichkeit für mich bedeutet, kannst du hier nachlesen: Ich verstehe die Menschheit nicht mehr – Gedanken über Verlässlichkeit (In dem Blogartikel habe ich auch ausführlicher darüber geschrieben, wann der Anspruch auf Verlässlich kritisch werden kann.)
In diesem Blogartikel hier geht es noch mal gezielt um den Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen“: Was steckt dahinter? Warum ist er so hartnäckig? Und wie kannst du ihn lösen?
Inhalt
Glaubenssätze, Grundannahmen & Lebensregeln
Wie entstehen Glaubenssätze?
Prägung in der Kindheit
Soziales Lernen
Wiederholte Botschaften
Einmalige Schlüsselerlebnisse
Kulturelle und gesellschaftliche Normen
Kompensationsstrategien
Welche Folgen hat der Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen“?
Wie kannst du diesen Glaubenssatz verändern?
Bestätigungskreislauf erkennen
Glaubenssatz wahrnehmen und anzweifeln
Was bedeutet Verlässlichkeit für dich? Was bedeutet es für andere?
Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen?
Verbindung oder Pflichtgefühl?
Verlässlichkeit beginnt bei uns selbst
Fazit: Selbstklärung ist der Anfang jeder echten Verlässlichkeit
Glaubenssätze, Grundannahmen & Lebensregeln
Fühle dich mal nacheinander in die folgenden zwei Sätze ein: „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen“ und „Ich kann mich auf mich selbst verlassen.“
Welchen Unterschied nimmst du zwischen diesen beiden Aussagen wahr? Spüre mal ganz genau hin.
Die erste Aussage, „Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen“, ist eine Grundannahme, die dich von deinen Mitmenschen distanziert. Wirkliche Nähe ist so nicht möglich. Als soziale Wesen brauchen wir diese aber. Verschiedene schmerzhafte Erfahrungen können dafür sorgen, dass du diese Grundannahme entwickelst.
Die zweite Aussage, „Ich kann mich auf mich selbst verlassen“, ist eine Grundannahme, die dich deinen Mitmenschen näher bringt. Durch diese Nähe bist du zwar verletzbarer, aber du bist gleichzeitig der Überzeugung, dass nicht alle Menschen schlecht sind und dass du Verletzungen und Enttäuschungen (irgendwann) verarbeiten kannst.
Grundannahmen sind also tief sitzende Glaubenssätze. Und ein Glaubenssatz ist ein Satz, den du dir selbst glaubst. Das kann kann ein hilfreicher Satz sein, wie z. B. „Ich bin gut genug“ oder ein problematischer Satz, wie eben z. B. der Satz „Ich bin auf mich selbst gestellt.“
Glaubenssätze, die eher oberflächlich sind, sind leichter zu verändern. Da reicht es manchmal schon, sich dieser bewusst zu werden. Die, die wir tiefer in uns verankert haben, können wir nicht so einfach mit Wissen allein loslassen. Denn aus diesen Grundannahmen entwickeln sich feste Lebensregeln, an denen wir uns unbewusst orientieren und die unsere innere Haltung formen. Wie z. B. die Regel: „Ich darf mich auf niemanden verlassen.“
Wie entstehen Glaubenssätze?
Wenn du lernen möchtest, dich wieder auf andere Menschen zu verlassen, hilft es, zu verstehen, wie der Glaubenssatz, dass du das nicht kannst, überhaupt entstehen konnte. Und das ist relativ einfach: Glaubenssätze und Grundannahmen, egal ob hilfreich oder problematisch, entstehen durch Lernerfahrungen, die ganz unterschiedlich ablaufen können.
Prägung in der Kindheit
Die meisten unserer Glaubenssätze und Grundannahmen haben ihre Wurzeln in der Kindheit. Hier wird einfach die Basis gesetzt: Alles, was wir danach erfahren, baut darauf auf. Unsere Erfahrungen in der Kindheit beeinflussen, wie wir spätere Erfahrungen einordnen und bewerten. In dieser Lernphase entstehen oft die tiefsten Grundannahmen.
Was mir hier ganz wichtig ist: Es geht nicht darum, Eltern oder anderen Bezugspersonen Schuld an etwas zu geben. Lass es uns bitte ganz nüchtern betrachten: Es geht allein darum, Einflüsse und Anteile zu erkennen. Niemand von uns macht alles richtig.
Natürlich kann ein Kind auch vorsätzlich geschädigt werden. Darum geht es hier aber nicht. Mir geht es hier um unbewusste Glaubens- und Verhaltensmuster, die z. B. Eltern an ihre Kinder weitergeben, weil sie es selbst nie anders gelernt haben und sich dessen gar nicht bewusst sind. Manchmal prallen auch einfach verschiedene Bedürfnisse aufeinander, die man in dem Moment vielleicht gar nicht direkt erkennt oder wo ein gesunder Umgang einfach noch erlernt werden muss.
So können Eltern z. B. kühl und abweisend auf das Nähebedürfnis ihres Kindes reagieren. Das Kind zieht unbewusst (!) Rückschlüsse und lernt: „Ich bin nicht liebenswert.“ Jemand, der sich als nicht liebenswert empfindet, wird dann z. B. immer zur Priorität machen, anderen zu gefallen (People Pleasing), damit er nicht abgelehnt wird. Denn wir sind soziale Wesen, wir brauchen eine soziale Gemeinschaft.
Soziales Lernen
Wir lernen jederzeit (nicht nur in der Kindheit) durch Beobachtung und Nachahmung. Wir übernehmen Haltungen, die wir z. B. in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis beobachten. Das heißt, wir müssen nicht jede Erfahrung selbst gemacht haben, um zu lernen. Wenn du z. B. immer wieder beobachtest, wie deine Geschwister oder deine Eltern Konflikten aus dem Weg gehen, lernst du „Streit ist gefährlich.“
Diese Lernerfahrung passiert einfach. Du machst sie nicht bewusst. Du denkst es nicht wortwörtlich. Du übernimmst einfach unbewusst bestimmte Ausweichstrategien, die nach einem bestimmten Marker folgen.
Ein Beispiel: Stell dir vor, ein Elternteil erhebt die Stimme. Für den anderen ist das sofort ein Marker: „Jetzt wird es kritisch.“ Anstatt zu bleiben, lenkt er schnell das Gespräch um, verlässt den Raum oder gibt klein bei. Das Kind beobachtet diesen Ablauf immer wieder: Lautstärke führt zum Ausweichen. Für das Kind entsteht daraus die unbewusste Regel: „Streit ist gefährlich, man muss ihm aus dem Weg gehen.“ Und genau so wird das Muster später im eigenen Leben weitergeführt. Oft ohne dass man merkt, warum man so reagiert. Der Marker ist dann zum Trigger geworden (Trigger = Auslöser, der einen inneren Prozess in Gang setzt, welcher zu einem bestimmten automatischen Verhalten führt).
Wiederholte Botschaften
Wir lernen außerdem sehr gut durch Wiederholungen. Wenn uns z. B. über Jahre hinweg immer wieder gesagt wird „Du bist zu empfindlich. Reiß dich mal zusammen.“, lernen wir: Gefühle zeigen und Bedürfnisse äußern ist Schwäche.
Manchmal werden diese Botschaften nicht direkt ausgesprochen, sondern subtil suggeriert – über Körpersprache, Mimik oder kleine Kommentare, die immer wieder mitschwingen.
Zum Beispiel: Ein Kind erzählt aufgeregt von etwas, das es verletzt hat. Die Eltern wechseln einen vielsagenden Blick, verdrehen die Augen oder seufzen leise. Vielleicht folgt noch ein knappes „Ach komm, so schlimm ist das doch nicht.“ Hier wird die eigentliche Botschaft nicht direkt ausgesprochen. Das Kind lernt aber: „Meine Gefühle sind übertrieben und nicht willkommen.“
Es gibt natürlich auch fließende Übergänge. So können sich z. B. Wiederholte Botschaften mit sozialem Lernen mischen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich beobachtet, wie zwei etwa 10-jährige Kinder miteinander in ein Spiel vertieft waren. Ein drittes Kind kam dazu und wollte mitspielen. Die beiden wollten das nicht, sie sagten dem dritten Kind, sie wollen allein weiter spielen. Dieses Kind ging dann zu einer Frau, ich nehme an, es war die Mutter, und erzählte ihr davon. Die Antwort der Frau zu dem Kind: „Die lassen dich nicht mitspielen? Die sind böse.” Das war alles. Und mit dieser Lernerfahrung hat das Kind die Situation verlassen.
Diese Lernerfahrung des dritten Kindes – mal angenommen, es kommt öfter zu solchen oder ähnlichen Situationen – ist in mehrfacher Hinsicht spannend. Lass uns dazu gern mal austauschen: Wenn du möchtest, schreib mir mal (in die Kommentare oder per Mail), was dieses Kind deiner Meinung nach wahrscheinlich gelernt hat und nun mit ins weitere Leben nimmt.
Vielleicht hast du auch eine Idee, warum die Mutter zu ihrem Kind gesagt hat, dass die anderen Kinder böse sind. Lass uns hier mal keine böse Absicht der Mutter unterstellen und auch nicht darüber urteilen. Es geht wirklich nur darum, zu verstehen, wie welche Anteile zustande kommen.
Schreib mir einfach mal deine Gedanken dazu. Ich würde mich sehr freuen. Auch wenn du Fragen hast: Immer her damit.
Einmalige Schlüsselerlebnisse
Wir lernen aber nicht nur durch wiederholte Erfahrungen, Beobachtungen oder Botschaften, sondern auch durch einmalige emotionale Erlebnisse.
Wenn sich z. B. ein Kind vor der Klasse blamiert, kann sich direkt der Glaubenssatz festsetzen: „Ich darf mich nicht zeigen, sonst werde ich ausgelacht.“
Wenn der beste Freund des Kindes plötzlich umzieht, dann kann das Kind daraus lernen: „Menschen, die mir wichtig sind, bleiben nicht. Ich darf mich nicht zu sehr binden.“
Auch einmalige Erlebnisse können also tiefe Spuren hinterlassen. Der Moment selbst geht vorbei. Da dieses Erlebnis aber mit starken Gefühlen verknüpft ist, bleibt die innere Schlussfolgerung haften und beeinflusst, wie wir später Beziehungen, Nähe oder Vertrauen erleben.
Kognitive Schlussfolgerungen
Wie du vielleicht schon erkannt hast, ist es nicht unbedingt das wiederholte Erleben oder das einmalige Ereignis selbst, das uns prägt, sondern die Art, wie wir es gedanklich einordnen: Wir ziehen unsere ganz eigenen Schlüsse und interpretieren Erfahrungen auf unsere ganz persönliche Weise. Daraus entstehen dann (oft sehr vereinfachte) innere Regeln – die vorhin schon erwähnten Lebensregeln.
Wenn wir bei einem Fehler ausgelacht werden, kann die Schlussfolgerung z. B. lauten: „Ich bin dumm.“ Aus diesem Gedanken entwickelt sich dann vielleicht die Regel: „Ich darf keine Fehler machen.“
Kulturelle und gesellschaftliche Normen
Glaubenssätze entstehen außerdem auch durch das, was „man so macht“ oder was in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft als selbstverständlich gilt. So werden z. B. Menschen, die immer beschäftigt sind und leicht gestresst wirken, oft als wichtiger und angesehener empfunden. Was zu der Schlussfolgerung führt, dass man hart arbeiten und immer leisten muss, um als Mensch etwas wert zu sein und anerkannt zu werden. Was natürlich ganz schlecht fürs Selbstwertgefühl und auch für die Gesundheit ist.
Ein anderes Beispiel, was wir bestimmt alle kennen ist die Aussage, dass Eigenlob stinkt. Daraus wächst die Lebensregel, dass man nicht stolz auf sich sein darf, was sich auch wieder negativ auf das Selbstwertgefühl auswirkt.
Oder, auch überall verbreitet: dieser typische Satz „Was sollen denn die Leute denken?“ Wenn wir mit dieser Frage aufwachsen oder einige Male damit konfrontiert werden, lernen wir: „Ich muss mich anpassen und darf nicht auffallen.“
Kompensationsstrategien
Manchmal entwickeln wir aber auch Glaubenssätze, um mit inneren Widersprüchen umzugehen. Wie z. B.: „Wenn ich Streit vermeide und mich immer anpasse, habe ich meine Ruhe.“ In dem Fall ist das ein problematischer Glaubenssatz, der nur kurzfristig Ruhe bringt, langfristig das Problem und damit auch die innere Unruhe verstärkt.
Welche Folgen hat der Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen“?
Es gibt, wie schon gesagt, auch hilfreiche Glaubenssätze und Grundannahmen, die dann auch zu sinnvollen und nachhaltigen Bewältigungsstrategien führen. Doch viele engen uns eben auch ein, machen uns klein oder halten uns davon ab, neue und positive Erfahrungen zuzulassen.
Vor allem dann, wenn sie unbewusst bleiben, steuern sie unser Verhalten wie eine unsichtbare Regel im Hintergrund. Sie wirken sich langfristig auf unser Selbstbild, unsere Beziehungen und unser Wohlbefinden aus. So auch der Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen.“
Zwischenmenschlich wirst du einfach Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen. Das ist ja nicht von Anfang an da, das muss sich entwickeln. Wenn du aber andere auf Distanz hältst, kann da nichts wachsen. Deine Beziehungen bleiben oberflächlich und brüchig. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass du dich einsam fühlst, auch dann, wenn du unter Leuten bist.
Da du ständig alles alleine stemmen willst oder musst, wirst du auch irgendwann überfordert und stressanfälliger sein. Unter Stress neigen wir eher dazu, von anderen enttäuscht zu sein. Und wenn du dich oft alleingelassen fühlst, entwickelst du leicht ein generelles Misstrauen gegenüber anderen. Das wiederum führt zu einer dauerhaften inneren Anspannung und einem starken Bedürfnis nach Kontrolle. Schließlich musst du ja immer alles im Blick behalten. Auf die anderen kann man sich ja nicht verlassen.
Hilfe anzunehmen wird immer schwieriger, was den Stress noch weiter erhöht und dauerhaft oben hält. Und das erhöht die Gefahr, in ein Burnout zu rutschen.
Spannend ist, dass dieser Glaubenssatz ursprünglich als Schutz entstanden ist. Aus Erfahrungen, wo du tatsächlich enttäuscht oder im Stich gelassen wurdest. Kurzfristig hat er also Sicherheit gegeben. Denn wenn du niemandem vertraust, kann dich auch niemand verletzen. Langfristig verhindert er aber stabile und unterstützende Beziehungen. Und das verursacht am Ende viel größere, tiefere und schädlichere Wunden.
Wie kannst du diesen Glaubenssatz verändern?
Die gute Nachricht ist: Was wir gelernt haben, können wir auch wieder ein Stück weit verlernen. Wenn wir gewisse Erfahrungen gemacht haben, werden die natürlich nicht gelöscht. Wir können sie aber aus einem anderen Blickwinkel bewerten und uns so für neue, bessere Erfahrungen öffnen.
Die nicht ganz so gute Nachricht: Es kann ein bisschen Zeit brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Grundannahmen verändern kannst. Der klassische Weg ist, dass du dir zunächst deiner Glaubenssätze und deren Wirkung bewusst wirst und diese mit gezielten Handlungen veränderst. Das braucht einige Wiederholungen und auch Rückschritte sind hier ganz normal. Erwarte bitte keine über-Nacht-Entwicklung.
Die bewusste Glaubenssatzarbeit kannst du (und solltest du auch) gut mit körperorientierten Methoden unterstützen. Zum Beispiel mit meditativen Übungen, die deine Selbstwahrnehmung trainieren oder mit körperlichen Übungen, die Stress abbauen und emotionale Blockaden lösen.
Ist der Glaubenssatz, dass du dich nur auf dich selbst verlassen kannst, sehr tief in dir verankert, könntest du auch Methoden wie Hypnose oder den Yager-Code nutzen, um leichter an den Kern der Sache zu kommen und die Veränderung zu beschleunigen.
Bestätigungskreislauf erkennen
In diesem Blogartikel geht es um die klassische bewusste Glaubenssatzarbeit. Und dafür ist es erst mal wichtig, zu verstehen, warum dein Glaubenssatz sich so hartnäckig hält.
Wenn du aufgrund deiner Lernerfahrungen z. B. glaubst, dass Menschen nicht mehr bereit sind, Abstriche zu machen und beim ersten größeren Problem direkt weg sind, wirst du dir genau das unbewusst (!) immer wieder bestätigen.
Man sucht unbewusst nach dem, was man kennt und möchte grundsätzlich seinen Zustand erhalten. Denn dieser Zustand, so schmerzhaft er auch ist, ist das, was einem vertraut ist. Und was einem vertraut ist, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Wenn du diesen Bereich verlassen würdest, wärst du dort erst mal neu und unsicher. Du kennst die standardmäßigen Abläufe nicht, das irritiert. Dann lieber doch so, wie man es gewohnt ist.
Diesen unbewussten Bestätigungskreislauf kannst du dir in etwa so vorstellen:
In dir wirkt der Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen.“ Dadurch wird deine Wahrnehmung verzerrt: Du achtest automatisch auf Situationen, die das bestätigen. Wenn z. B. jemand mal nicht pünktlich ist, fällt das sofort auf. Wenn hingegen jemand zuverlässig war, blendest du das unbewusst aus. Oder du bewertest es als Ausnahme. Unbewusst verhältst du dich außerdem so, dass Nähe oder Vertrauen gar nicht erst entstehen kann. Vielleicht nimmst du aufgrund deiner Annahme keine Hilfe an und ziehst dich emotional zurück. Dein Umfeld reagiert auf dein Verhalten: Deine Mitmenschen fühlen sich abgelehnt oder überflüssig. Daraufhin ziehen sie sich zurück oder übernehmen keine Verantwortung, weil sie merken, dass du eh alles selbst machen willst. Und genau das bestätigt und nährt wieder deinen ursprünglichen Glaubenssatz: „Siehst du, man kann sich auf niemanden verlassen.“ Damit beginnt die nächste Runde. Und mit jeder neuen Runde tritt sich diese Annahme weiter fest.
Glaubenssätze sind also nicht nur Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie wirken sich tagtäglich auf unsere Wahrnehmung und Entscheidungen aus. Wir beweisen uns im Alltag immer wieder, dass unsere Annahmen wahr sind.
Glaubenssatz wahrnehmen und anzweifeln
Deswegen besteht der erste Schritt darin, diesen Glaubenssatz zu erkennen und anzuzweifeln. Immer und immer wieder. Nur was wir bewusst wahrnehmen, können wir gezielt verändern.
Wenn du deinen Glaubenssatz anzweifelst, heißt das nicht, dass du dir ab sofort das Gegenteil vorbeten sollst. Die Affirmation „Ich kann mich auf meine Mitmenschen verlassen“ klingt zwar schön und gesund, du wirst sie dir aber wahrscheinlich nicht glauben.
Du brauchst keine Affirmation und auch keinen neuen Glaubenssatz – zumindest jetzt noch nicht. Alles, was du brauchst, ist ein ernstgemeinter Zweifel: „Was, wenn das, was ich annehme, gar nicht stimmt?“
Probiere es direkt mal aus: Sage dir, dass du dich nur auf dich selbst verlassen darfst und spüre mal hin, wie sich dieser Satz in deinem Körper anfühlt. Und dann zweifle ihn mal an und sage wortwörtlich – in Gedanken oder laut : „Was wenn das nicht stimmt?“ Spüre auch hier wieder hin, wie sich diese Frage in deinem Körper anfühlt, was sich sofort verändert.
Du musst gar keine Antwort darauf finden. Nur den Glaubenssatz wahrnehmen, hinspüren, den Gedanken anzweifeln und wieder hinspüren. Immer, wenn du merkst, dass sich das Gefühl oder der Gedanke von „Ich darf mich auf niemanden verlassen“ einstellt. Immer. Jedes Mal. Schon allein dadurch wird sich etwas verändern – wenn du aufmerksam dir gegenüber bleibst.
Was bedeutet Verlässlichkeit für dich? Was bedeutet es für andere?
Ich hatte ja zu Beginn schon mal erwähnt, dass Verlässlichkeit für jeden etwas anderes bedeuten kann. Nun möchtest du wahrscheinlich von Menschen umgeben sein, die darunter dasselbe verstehen wie du. Deswegen solltest du dir als nächstes darüber klar werden, was du alles mit Verlässlichkeit verbindest. Also: Was bedeutet Verlässlichkeit für dich persönlich? Wie würdest du sie jemandem beschreiben, der sie noch nie erlebt hat?
Für den einen bedeutet es, dazubleiben, was auch immer passiert. Für den anderen heißt es vor allem, dass man ehrlich ist und miteinander über alles reden kann. Natürlich bedeutet Verlässlichkeit für viele Menschen sicherlich auch, dass sich an Versprechen gehalten wird. Dennoch kann es hier Grenzen geben. Deswegen wäre die nächste Frage, über die du dir klar werden solltest: Welche Grenzen wären hier für dich denkbar? Wann wäre es nachvollziehbar und in Ordnung (wenn auch schmerzhaft), Versprechen nicht zu halten?
Es kann helfen, wenn du du all deine Gedanken zu diesem Thema mit Hilfe des Freewritings sortierst und festhältst.
Schreibe ruhig erst mal wild durcheinander und ziehe dann – am besten auch wieder schriftlich – dein Fazit.
Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen?
Wir wünschen uns Verlässlichkeit von anderen, weil wir ein tiefsitzendes Grundbedürfnis nach Sicherheit haben. Nun kann auch dieses Bedürfnis unterschiedlich erfüllt werden. Manche Menschen geben uns Sicherheit, indem sie einfach immer da sind. Sie melden sich täglich, sind immer erreichbar. Andere sind vielleicht eher still und zurückhaltend was regelmäßigen Kontakt angeht, dafür weiß man aber genau: Wenn es drauf ankommt, sind sie da.
Wenn du dich fragst, was Verlässlichkeit für dich bedeutet, dann frage dich auch: Welche Signale anderer geben dir das Gefühl von Sicherheit? Und woran merkst du, dass du innerlich beginnst, dich von bestimmten Menschen zurückzuziehen, weil sie dir eben nicht ausreichend Sicherheit vermitteln?
An dieser Stelle ist es auch wichtig, nach einem alternativen Halt zu schauen. Denn es kann immer gute Gründe geben, warum wir dieses Gefühl von Sicherheit in anderen (auch sonst verlässlichen) Menschen gerade nicht finden können: Was, außer der Beziehung, kann dir helfen, dich sicherer zu fühlen? Das kann etwas im Außen sein (z .B. Rituale) oder auch etwas im Inneren (hilfreiche Gedanken und Erinnerungen, innere Bilder …).
Prüfe auch mal, wie es um dein soziales Netz insgesamt steht. Wir können und sollten uns nicht nur auf eine einzige Person allein stützen. Es ist wichtig, dass es noch ein paar andere Menschen in unserem Leben gibt. Das müssen nicht unbedingt festen Freundschaften sein. Auch lockere Bekanntschaften können entlasten und Sicherheit vermitteln.
Verbindung oder Pflichtgefühl?
Verlässlichkeit wird oft mit Loyalität und Dazugehören verknüpft. Daraus kann sich schnell ein unausgesprochenes Pflichtgefühl entwickeln: Man bleibt aus Anstand und meldet sich, weil man muss. Tut man das nicht, fühlt man sich schuldig. Innerlich ist man aber schon ganz weit weg.
Es geht also auch immer um die Frage: Bist du wirklich zuverlässig da, da weil du da sein möchtest? Oder ist es eigentlich nur noch eine Last?
Mal angenommen, du weißt, dass ein Mensch nur noch da ist, weil er es mal versprochen hat. Und du weißt auch, wie unwohl er sich inzwischen mit diesem Versprechen fühlt und wie unglücklich er mit der Situation ist: Was gibt dir diese Beziehung noch? Wie fühlt es sich für dich an, immer da und dennoch unerwünscht zu sein?
Ich weiß, die Frage ist ein bisschen hart und die Antwort darauf möglicherweise nicht leicht zu verdauen. Aber es ist wichtig, dass man sich mal bewusst macht, womit man seine Lebenszeit verbringt.
Verlässlichkeit beginnt bei uns selbst
Auch, wenn wir uns viel damit befasst haben, was wir uns von anderen wünschen, wenn es um Verlässlichkeit geht, blitzt die ganze Zeit schon immer mit durch, dass Verlässlichkeit bei uns selbst beginnt.
Du kannst all unsere angesprochenen Punkte noch mal durchgehen und dich bei jedem einzelnen fragen: Kann ich das, was ich mir von anderen wünsche, selbst geben – meinen Mitmenschen aber auch mir?
Wenn du jetzt heftig mit dem Kopf nickst und dir sagst, „Also an mir liegt es nicht. Ich bin ja immer da und halte mein Wort. Ich bin die Person, die von anderen im Stich gelassen wird”, dann geh bitte noch mal zurück zum zweiten Teil der Frage. Denn oft fällt es leichter, für andere Menschen verlässlich zu sein, als für sich selbst.
Frage dich wirklich ernsthaft: Halte ich die Versprechen, die ich mir selbst gebe? Stehe ich zu meinen Bedürfnissen oder schiebe ich sie weg, wenn es unbequem wird? Welche kleinen Versprechen an mich selbst habe ich in letzter Zeit nicht gehalten? Wo nehme ich mich vielleicht selbst nicht ernst genug?
Denke an den Bestätigungskreislauf: Wir wir mit uns selbst umgehen, legt die Messlatte dafür, wie andere mit uns umgehen dürfen. Unsere Grundannahmen beeinflussen unsere Kommunikation und unser Verhalten. Kommunikation findet nicht nur durch Worte statt. Menschen lesen in anderen Menschen – ohne, dass sie sich dessen bewusst sein müssen. Wenn ich jemand bin, der ständig Grenzüberschreitungen zulässt und auf einen Menschen treffe, der ständig Grenzen überschreiten „muss“, ergänzt sich das perfekt. Wir würden uns gegenseitig anziehen und als passend empfinden, weil sich unsere unbewussten Grundannahmen hier gut vereinen. Weil es das ist, was wir kennen.
Wenn du das Gefühl hast, die Geschichten wiederholen sich und du kannst ein gewisses Muster in deinen sozialen Beziehungen erkennen, schaffe unbedingt ein Bewusstsein für deine Grundannahmen. Nimm den Glaubenssatz „Ich darf mich nur auf mich selbst verlassen“ mit ehrlicher Neugier unter die Lupe. Es geht hier noch gar nicht um Lösungen und Veränderungsschritte. Das Erkennen der Grundannahmen und das Beobachten im Alltag ist zunächst wichtig.
Wenn du hierbei – und auch bei entsprechenden Veränderungsschritten – gerne Unterstützung hättest, schreib mir einfach oder lass uns kurz reden (kostenfrei & unverbindlich). Dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich am besten begleiten kann.
Fazit: Selbstklärung ist der Anfang jeder echten Verlässlichkeit
Der Glaubenssatz „Ich darf mich auf niemanden verlassen“ entsteht selten von heute auf morgen. Dahinter stecken meist Erfahrungen aus der Kindheit oder aus prägenden Beziehungen, in denen das Vertrauen enttäuscht wurde. Dieses Gefühl, immer auf sich allein gestellt zu sein, wenn es darauf ankommt, verankert sich tief. Und es wirkt auch dann noch weiter, wenn die ursprüngliche Situation längst vorbei ist.
Dieser Glaubenssatz hält sich sehr hartnäckig, weil er dich vermeintlich schützt: Wenn du nichts erwartest, wirst du nicht verletzt. Wenn du alles alleine regelst, behältst du die Kontrolle. Gleichzeitig hat er dich an manchen Stellen auch getragen: Er hat deine Selbstständigkeit gefördert, dir Sicherheit gegeben und geholfen, schwierige Situationen aus eigener Kraft zu bewältigen.
Doch inzwischen zeigt er mehr und mehr seine Schattenseite. Denn er engt auch ein: Er verhindert, dass du Nähe, Unterstützung und Entlastung zulässt, was dir eigentlich guttun würde. Er lässt dich misstrauisch bleiben, selbst dort, wo Vertrauen möglich wäre.
Lösen lässt er sich nicht über Nacht. Du kannst ihn aber Schritt für Schritt hinterfragen: Woher kommt er wirklich? In welchen Situationen hat er mich bisher gestützt? Und wo engt er mich inzwischen ein? Es hilft auch, bewusst kleine Gegenbeweise zu sammeln: Momente, in denen andere tatsächlich verlässlich waren. Genauso wichtig ist es, dass du selbst verlässlicher mit deinen eigenen Bedürfnissen und Grenzen umgehst.
So wandelt sich nach und nach deine innere Haltung von „Ich darf mich auf niemanden verlassen“ zu „Ich darf ausprobieren, wem ich vertrauen kann. Und ich darf mir selbst zutrauen, mit Enttäuschungen umzugehen.“
Foto von Thomas Kelley via Canva.com
Ich schreibe dir etwa 4x im Monat – immer dann, wenn’s hier was Neues gibt, ich ein paar Gedanken mit dir teilen oder dich an etwas erinnern möchte. Alle 3 Monate gibt es ein paar zusätzliche Mails, in denen ich dich zu kurzen Reflexionen mit Hilfe der psychologischen Tarot-Arbeit anleite.
Du kannst mir jederzeit auf meine Mails antworten, wenn du deine Gedanken mit mir teilen möchtest. Ich freue mich immer über einen kurzen Austausch. 😊
Die Menschenfieber-Post ist für dich kostenfrei. Möchtest du irgendwann keine Mails mehr bekommen, kannst du dich jederzeit mit nur einem Klick wieder abmelden.
Ich versende die Mails über einen deutschen Newsletter-Anbieter mit hohen Datenschutz-Standards. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung.
Einfach anfangen: Kleine Schritte für mehr Ruhe & klare Grenzen > als Workshop oder im 1:1 >>> mehr Infos & Anmeldung
Hi, ich bin Anett. Ich unterstütze vor allem introvertierte, sensible und empathische Menschen dabei, sich von Druck und Erwartungen anderer zu befreien, Konflikte wertschätzend zu lösen und Stress zu reduzieren. Hinter den Kulissen immer an meiner Seite: meine beiden Hunde aus dem Tierschutz – Suri und Nanni.
Meine neuesten Blogartikel
Gesunde Abgrenzung im Alltag: Wenn Verantwortung neue Grenzen formt
Abgrenzung hat einen schlechten Ruf. Viele denken dabei an jemanden, der dichtmacht oder sich zurückzieht. Dabei steckt oft mehr dahinter, als man auf den ersten Blick merkt. Wer lernt, für sich einzustehen, erkennt erst nach und nach, wie sich die eigene Haltung verändert: welche Situationen Kraft kosten, wo man ruhig bleiben kann und wie man klar bei sich bleibt, ohne sich zu überfordern. In diesem Monatsimpuls geht es darum, diese Veränderung wahrzunehmen und anzuerkennen.
Monatsrückblick Januar 2026: Rauhnächte, Workshop & Tarot-Abend
Mein Januar war an sich ruhig, stellenweise aber auch fordernd. Die Rauhnächte sind zu Ende gegangen, der neue Grundlagen-Workshop ist online und Ende des Monats gab es wieder einen Tarot-Abend. Parallel dazu hat mich privat vor allem mein Hund Nanni beschäftigt, inklusive Tierarztterminen und Rückschritten.
Freundlich Nein sagen: 12 klare Sätze für den Alltag
Viele glauben, Grenzen setzen muss immer richtig beeindruckend sein. Und vielleicht sogar laut. Sonst zählt das Nein nicht. Oft kommt dann noch die Sorge dazu, andere zu enttäuschen. Dabei geht es gar nicht darum, besonders durchsetzungsstark rüberzukommen. Grenzen funktionieren auch, wenn sie kurz, klar und freundlich sind. In diesem Artikel zeige ich dir 12 Sätze, mit denen du Abstand schaffen kannst, ohne unfreundlich zu wirken.

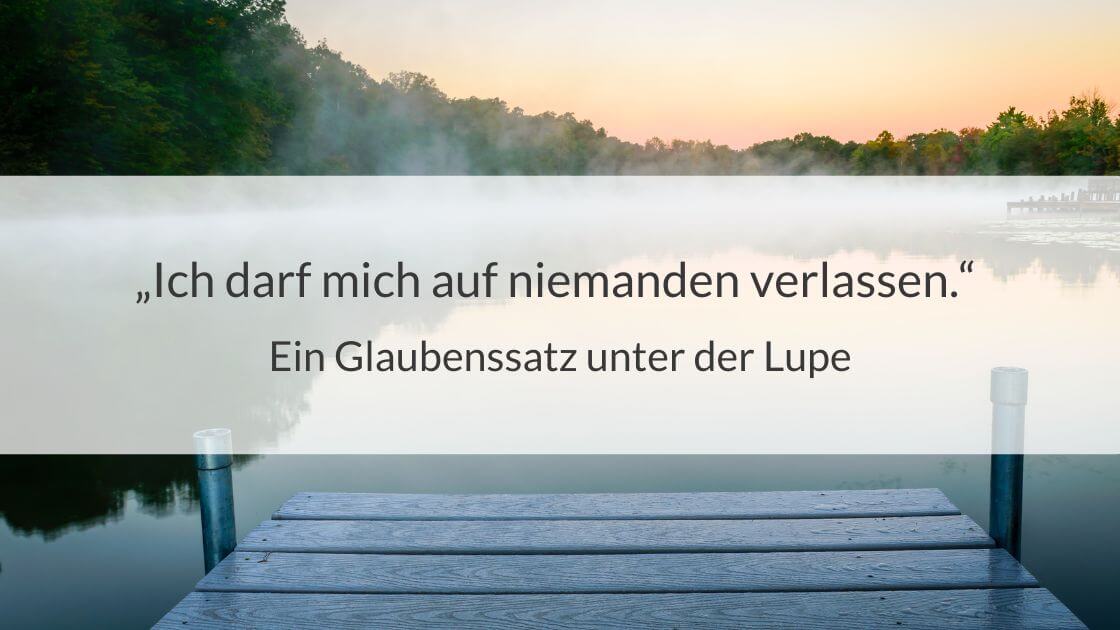
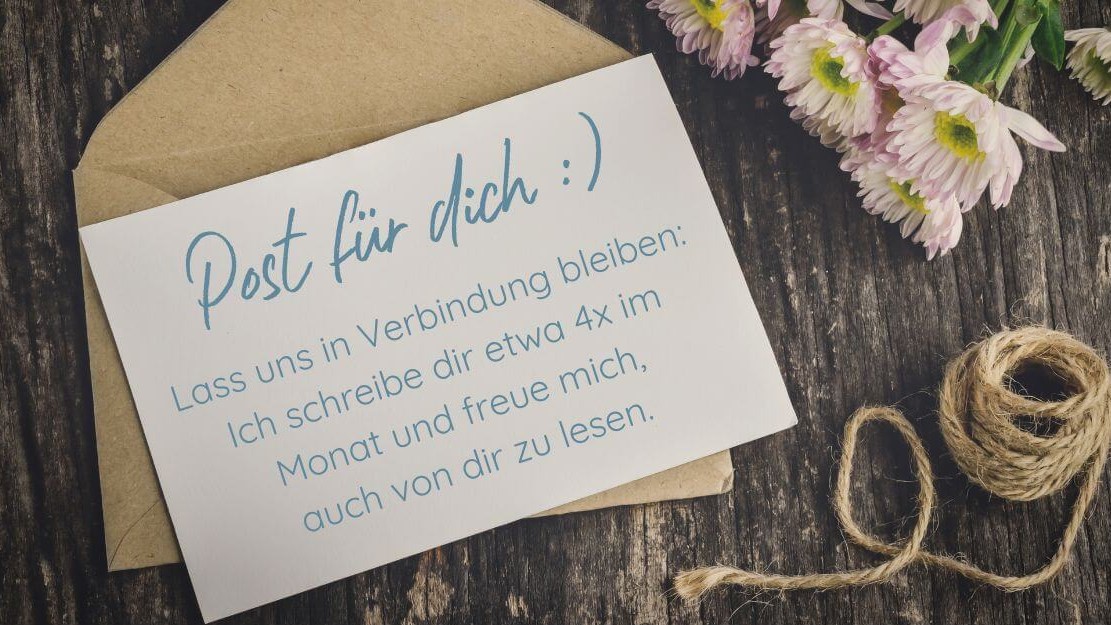

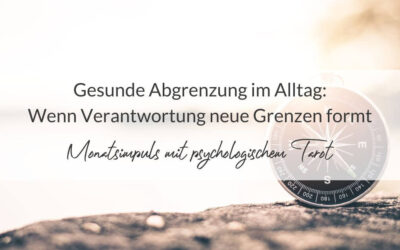


Liebe Anett,
danke für deinen wertvollen Artikel, damit erwischst du mich an einem sensiblen Punkt, denn genau diesen Glaubenssatz trage ich schon sehr lange mit mir herum. Ein einmaliges Erleben, das sich tief, sehr tief eingegraben hat und mich gehalten hat in all den Jahren danach.
Umso glücklicher bin ich, dass ich ihn kenne und kommunizieren kann, endlich auf Augenhöhe und tatsächlich inzwischen Gegenbeweise zu sammeln in der Lage bin.
Ich bleibe dran und wähle bewusst, dass ich – und vor allem WEM ich – inzwischen vertrauen kann.
Eine wahre Bereicherung und Wohltat:-)
Viele Grüße zu dir
Gabi
Liebe Gabi,
danke fürs Lesen und fürs Teilen deiner Erfahrung. Es ist schön, zu lesen, dass du für dich einen guten Weg gefunden hast, diesen Glaubenssatz zu entkräften. „Ich bleibe dran und wähle bewusst“ – damit bringst du wunderbar auf den Punkt, worum es im Kern immer wieder geht.
Herzliche Grüße
Anett